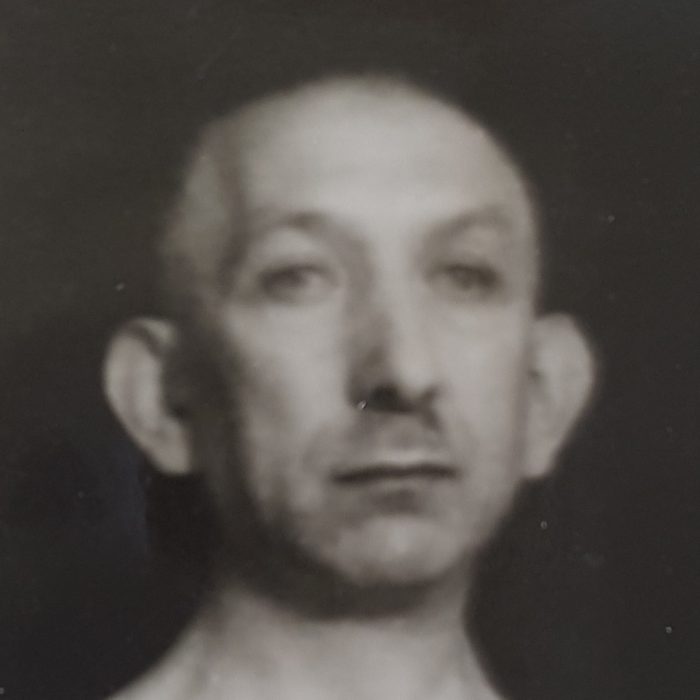»Mikroskope waren die heutigen iPhones« – ein Interview mit Alfons Renz
Von Hendrik Schirner
Die Ausstellung »Entgrenzte Anatomie« widmet sich in einer Vitrine zum »Blick unter die Haut« den Mikroskopen, die maßgeblich zur Professionalisierung der anatomischen Arbeit beitrugen. Dieser Blogbeitrag möchte die bereits in der Ausstellung vorhandenen Informationen ergänzen. Aus diesem Grund habe ich ein Interview mit dem Parasitologen und Vorsitzenden der Tübinger Mikroskopischen Gesellschaft PD Dr. Alfons Renz geführt. Renz interessiert sich bereits seit seiner Jugendzeit für die Mikroskopie, hat am Arbeitsplatz damit zu tun und gründete in den 1990er Jahren die Tübinger Mikroskopie Gesellschaft. Sie zählt heute mit rund 70 Mitgliedern zu den bedeutendsten in Deutschland. Im Interview spricht er über die Entwicklung der Mikroskopie in Tübingen, über das Anfertigen von Präparaten sowie über die Mikrotome Christian Erbes.
Hendrik Schirner: Nachdem die ersten Mikroskope bereits im 17. Jahrhundert erfunden wurden, hielten diese am Anatomischen Institut in Tübingen im Jahr 1803 Einzug. Wie hat sich die Arbeit an Mikroskopen am Anatomischen Institut seitdem entwickelt?
Alfons Renz: Die ersten Mikroskope, die nach Tübingen kamen, gehen auf eine Schenkung des Esslinger Mäzenen Baron De Palm zurück. In den Annalen der Fakultät werden diese Mikroskope als ›microscopicum praestaetissimum et elegantissimum‹ beschrieben. Weiterhin erfolgte ab den 1840er-Jahren, ausgehend von Großbritannien, eine Professionalisierung der Mikroskopie, die auch Tübingen erfasste. Wurde sie zuvor eher als Zeitvertreib – insbesondere reiche Personen nutzten Mikroskope als Statussymbol – gesehen, so setzte sich Hugo von Mohl in Tübingen für eine professionellere Nutzung ein. Durch seine mikroskopischen Sammlungen und Niederschriften, die zum Teil bis heute erhalten sind, gewinnen wir einen Einblick in den sich entwickelnden Bereich der Mikroskopie in Tübingen.
Diese spielt für die Anatomie insofern eine Rolle, als dass der Feinbau der Organe untersucht werden kann. Hier machte sich ab den 1850er Jahren die sogenannte Würzburger Schule um Franz von Leydig einen Namen. Leydig begründete die Vergleichende Histologie der Tiere und des Menschen. 1857 wurde er als erster Ordinarius der Zoologie und Vergleichenden Anatomie nach Tübingen berufen. Er arbeitete mit einem Mikroskop von Friedrich Belthle, einem Tübinger Mechaniker, der in Wetzlar das Optische Institut übernommen hatte.
Die Anfang des 19. Jahrhunderts begründete Dynastie Tübinger Mechaniker spielte eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Tübinger Professoren mit wissenschaftlichen Geräten. Insbesondere Eugen Albrecht wurde später von der medizinischen Fakultät angestellt und erhielt eine Werkstatt im Untergeschoss dieser. Zuvor betrieb er eine freie Werkstatt. Dass er weiterhin versuchte, seine Gerätschaften zu verkaufen, wurde von den Professoren missbilligt, sodass seine unternehmerischen Tätigkeiten bald einschliefen.
Können Sie kurz den Weg beschreiben, der Martin Heidenhain und Paul Graf zusammengeführt hat?
Besagter Eugen Albrecht lernte auch den Mechaniker Paul Graf an. Auf seine Empfehlung hin wurde dieser 1914 ebenfalls an der Universität angestellt und arbeitete dort am Anatomischen Institut eng mit Martin Heidenhain zusammen. Er stieg während seiner Laufbahn zum Oberpräparator und später zum Technischen Inspektor auf. In 44 Jahren, die er an der Universität arbeitete, stellte Graf über eine Millionen Präparate her. Politisch gesehen war er überzeugter Sozialdemokrat. Für seine Verdienste erhielt Graf 1958 das Bundesverdienstkreuz.

Martin Heidenhain war Sohn eines Physiologen aus Breslau, er kam aus einer Medizinerfamilie. Er studierte zunächst in Breslau, um dann nach Würzburg zu wechseln und dort von der schon angesprochenen Würzburger Schule zu profitieren. 1899 kam er nach Tübingen und blieb 50 Jahre lang die prägende Gestalt der dortigen Anatomie. Seine Aufgaben lagen hier insbesondere im Bereich der anatomisch histologischen Kurse der Menschen und Wirbeltiere.
Woher stammt die Motivation Grafs und Heidenhains, die unglaubliche Zahl von jährlich über 50.000 Präparaten anfertigen zu lassen?
Im Tübingen des ausgehenden 19. Jahrhunderts hatte Hugo von Mohl das Protoplasma und Friedrich Miescher das Nuklein des Zellkerns als Grundbestandteile aller Zellen erkannt. Jetzt galt es, diese Strukturen durch gezielte Anfärbung unter dem Mikroskop erkennbar zu machen, worin allen voran Heidenhain interessiert war. Dieser hatte dazu die noch heute gebräuchlichen Färbungen mit AZAN und HE, einer Mischung von Hämatoxylin und Eosin und entwickelt. Nur durch diese und andere, teils hochspezifische Färbungen lassen sich die jeweiligen Zellen und Strukturen der verschiedenen Gewebe des menschlichen (und tierischen oder pflanzlichen) Körpers richtig ansprechen. Dies ist Aufgabe der Histologie.

Heidenhains histologische Kurse waren unter den Studierenden sehr beliebt. Hinter der hohen Anzahl an Präparaten stecken auch praktische Überlegungen: Dadurch, dass die Studierenden die Präparate mitnehmen konnten, wurden sie im ganzen Reich verteilt und steigerten so die Bekanntheit der Tübinger Anatomie. Welche Werbung ist besser? Zur hohen Anzahl an Präparaten, für deren Entstehen vor allem Graf im Auftrag von Heidenhain verantwortlich war, kam es auch durch die Mitnahme der Studierenden.
Die Präparate, von denen teilweise noch Zeichnungen bestehen, wurden schließlich in speziellen Präparatekästen von den Studierenden mitgenommen. Auch heute noch erfreuen sich die Präparate von Graf und Heidenhain einer hohen Beliebtheit und dienen etwa als exemplarische Abbildungen in Lehrbüchern. Auch deshalb, weil sie sich durch ihre Qualität der Färbung von anderen Präparaten abheben.
In Ihrem Forenbeitrag beschreiben Sie bereits, wie die Präparate angefertigt wurden. Können Sie das noch etwas ausführen?
Die möglichst frischen Organe wurden zunächst fixiert – auch dazu hatte Heidenhain eine eigene Mischung von Quecksilbersalzen entwickelt (SUSA) –, dann über aufsteigende Alkoholreihen entwässert, mit Paraffin durchtränkt und in Blöcken ausgehärtet. Diese ca. 1 x 1 cm großen Organblöcke werden mit einem Mikrotom in hauchdünne Scheiben geschnitten, die wie ein Band aneinanderhaften. Diese Bänder werden in Reihen auf etwa handtellergroße Glimmerplatten aufgezogen. Dazu werden diese mit Hühnereiweiß bestrichen, sodass die Schnittbänder, so wie sie das Mikrotom liefert, unverrückbar darauf kleben. Anschließend folgen die Entparaffinierung, Färbung und Entwässerung.

Aus dieser Platte mit ca. 10 x 10 Einzelschnitten wurde beim Gang durch die Reihen pro Studierenden jeweils ein Schnitt mit einer Schere abgeschnitten. Ich vergleiche das gerne mit einer Rolle Briefmarken, die nacheinander abgetrennt werden. Die Studierenden hatten dann die Aufgabe, die Schnitte auf Objektträgern einzubetten. Dies geschah mit einem Tropfen Xylol und einem Tropfen Kanadabalsam (Einbettungsmittel). Dann wurde das Präparat mit einem Deckglas bedeckt. Wichtig war die anschließende, ausführliche Beschriftung des Präparats von den Studierenden mit Hilfe eines Klebeetiketts. Dabei wurde sorgfältig darauf geachtet, dass die Studierenden in ihren Präparatekästen die Beschriftung entsprechend der Schnittfolge eingetragen haben.
Was hat es mit den Mikrotomen des Tübinger Unternehmens Christian Erbe auf sich?
Mikrotome werden verwendet, um mikroskopische Schnittpräparate herzustellen. Dazu werden die Organe entweder eingefroren, oder wie oben beschrieben, in Paraffin eingebettet und mit einem sehr scharfen Messer in feine Scheiben geschnitten, ca. 8 bis 10 µm dick. Im Anatomischen Institut wurden viele verschiedene Konstruktionen von Mikrotomen verwendet.

Der Tübinger Mechaniker Christian Erbe hat solche Mikrotome hergestellt und vertrieben. Im Gegensatz zu anderen Tübinger Mechanikern, die wie der bereits angesprochene Eugen Albrecht als Angestellte der Universität tätig waren, handelte Christian Erbe hauptsächlich selbständig unternehmerisch. Daraus folgt auch, dass er die meisten seiner Mikrotome – ausgenommen die von ihm selbst weiterentwickelten Gefriermikrotome – nicht in seiner Werkstatt gebaut hat, sondern diese lediglich vertrieb. Gleiches gilt für die Präparatekästen der Heidenhainschen Kurspräparate, deren Stempel ‚C. Erbe Tübingen‘ ihre Provenienz leicht verrät. Für seine Leistungen wurde Christian Erbe auf den Weltausstellungen in Antwerpen und Chicago ausgezeichnet. Die Firma Erbe hat sich heute zu einem weltweit agierenden Hersteller von Medizintechnik entwickelt. Bis heute bin ich auf der Suche nach einem Erbe-Mikrotom, konnte bisher aber noch keines ausfindig machen.
Wie schätzen Sie als Mikroskopie-Experte die Zukunft der Mikroskopie in Tübingen ein?
Sowohl in der Medizinischen wie auch in der Naturwissenschaftlichen Fakultät wurden neue Zentren der Hochleistungsmikroskopie eingerichtet. Innovative Methoden, wie die Laserscanning- oder die 2-Photonen Hochauflösungsmikroskopie – dafür gab es einen Nobel-Preis! – in Verbindung mit digitalen Bilderfassungstechniken und Fluoreszenz-Markierung, bilden die Forschungsfront in den Biowissenschaften. Sie erlauben den Blick in die Funktion einzelner, lebender Zellen. Bei einem Preis von jenseits einer halben Million sind solche Geräte jedoch für Privatforscher unerschwinglich.
In der medizinischen, pharmakologischen und biologischen Routine hat das Mikroskop schon jetzt nicht mehr die gleiche Bedeutung wie etwa vor 50 bis 100 Jahren, als noch jeder Arzt oder Apotheker täglich damit arbeitete. Forschungsmikroskope, die früher das Jahresgehalt eines Wissenschaftlers kosteten, sind jetzt auf dem Gebrauchtmarkt für wenig Geld zu haben. Der günstige Preis hochprofessioneller Ausrüstung mit Hochleistungsoptiken ermöglicht einen größeren Zugang für Laien, die sich in der Mikroskopie ausprobieren wollen. Darin sehe ich auch eine positive Entwicklung: Vor allem im Bereich digitaler Mikroskopie, welche exzellente Fotografien liefert. Trotz oder gerade wegen dieser Herausforderung sehe ich der Zukunft der Mikroskopie erwartungsvoll entgegen.
In Tübingen gab es sogar das in der deutschen Forschungslandschaft einmalige Institut für Wissenschaftliche Mikroskopie der damaligen Fakultät für Theoretische Medizin. Es wurde leider Ende der 1980er-Jahre geschlossen – in der voreiligen Annahme, dass sich keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse mehr in der Lichtmikroskopie gewinnen ließen. Dass gerade die Lichtmikroskopie durch neue Verfahren, digitale Techniken und molekulare Methoden der Objektmarkierung einen ungeahnten Schwung erhalten, ja sogar nobelpreiswürdige Ergebnisse liefern könnte, wagte damals niemand zu ahnen.